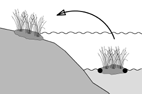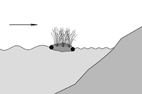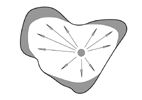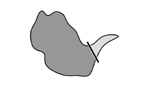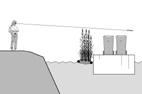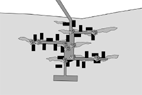| 5. Mögliche Anwendungen “Lebender Inseln” |
"Lebende Inseln" schaffen die Voraussetzungen für die Entwicklung
intakter, naturnaher Uferbereiche:
Durch schwimmende Pflanzeninseln mit der typischen Vegetation
der Uferbereiche (z.B. Scirpo-Phragmitetum), wird bereits während des
Wasseranstiegs eine zukünftige Ufervegetation vorkultiviert. Sobald der
Endwasserstand erreicht ist, kann die Vegetation am Ufer fixiert werden.
Sie verwächst dort mit dem Boden und wird zur permanenten Uferbegrünung
(Abb.5.1).
"Lebende Inseln" sind Lieferanten für standortangepasste Pflanzen,
die vielseitig verwendbar sind, bei der Sanierung, bei der Anlage von
Feuchtbiotopen oder zur Uferbegrünung.
"Lebende Inseln" schützen während und nach der Flutung
die Ufer vor Wellenerosion durch ihre wellendämpfende Wirkung (Abb. 5.2).
Bei Versuchen im Wellenkanal der Universität Hamburg dämpften schwimmende
Röhrichte Windwellen um bis zu 90% und künstlich Wellen (Schifffahrt)
um bis zu 70 % (vgl. GROSSMANN 1998).
Wind und Strömung verbreiten die Samen “Lebender Inseln”
an die Ufer und sorgen damit jährlich für die Ansaat von Röhricht (vgl.
KRAUSCH 1965)(Abb. 5.3).
“Lebende Inseln” sind Lebensräume. Sie schaffen günstige Mikroklimate
für die Besiedelung durch Pflanzen und Tiere. Wasservögeln dienen sie
als Nist- und Brutorte, Fischen als Unterstände (Abb. 5.4 u. 5.5). |
|
| |
| |
| |
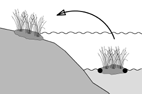 |
| Abb. 5.1. |
| |
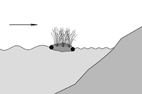 |
| Abb. 5.2. |
| |
| |
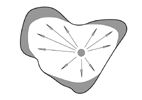 |
| Abb. 5.3. |
| |
 |
| Abb. 5.4. |
| |
 |
| Abb. 5.5. |
| |
| |
|
"Lebende Inseln" sind eine funktionale und ästhetische Ergänzung
von Einrichtungen am und auf dem Wasser:
Uferbereiche, z. B. Strandanlagen, können mit "Lebende Inseln"
abwechslungsreich gestaltet und räumlich gegliedert werden.
Zonen verschiedener Nutzungen lassen sich durch linear
angeordnete Inseln naturnah voneinander abtrennen (Abb. 5.6).
"Lebende Inseln" bieten einen natürlichen Sichtschutz,
z. B. für Boote, Leitungen oder Pontons (Abb. 5.7).
Als gestalterische Elemente eingesetzt, werten "Lebende
Inseln" Anlagen wie Marinas, schwimmende Häuser oder Strandbäder auf und
bringen Grünflächen auf das Wasser (Abb. 5.8 u. 5.9.).
|
|
| |
| |
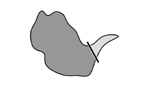 |
| Abb. 5.6. |
| |
| |
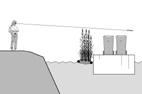 |
| Abb. 5.7. |
| |
| |
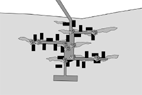 |
| Abb. 5.8. |
| |
 |
| Abb. 5.9. |
| |
| |
|
|
|
|
|